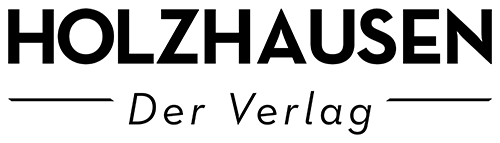Wissen
teilen.
Zukunft
Formen.
„Gemeinsam gestalten wir die Zukunft unserer Branchen.“
Über uns
Im VERLAG HOLZHAUSEN treffen Tradition und Innovation aufeinander.
Wir sind bekannt für unsere vielfältigen Wissenschafts- und Fachpublikationen, die anwenderorientierte Brancheninformationen, neueste Entwicklungen, wertvolle Erkenntnisse sowie spezielle Themenbereiche und Best Practices umfassen. Unser Leitmotiv „Wissen teilen. Zukunft formen.“ spiegelt unsere Leidenschaft wider, hochwertige Fachinhalte zu produzieren mit einem permanenten Streben nach Fortschritt.
Durch unsere Fachpublikationen und Branchenveranstaltungen schaffen wir eine Plattform, die den Austausch von Fachwissen und Ideen fördert. Damit unterstützen wir Sie beim Aufbau und der Pflege Ihres beruflichen Netzwerks, der Marke und der Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten.
Gemeinsam bilden wir eine lebhafte Community von Experten, die aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitwirken.
Print Medien
Wir sind spezialisiert auf die Betreuung verschiedener Branchen, darunter Innovation-, Forschungs- und Technologieunternehmen, Seilbahnen, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik oder Logistik und Transport. Mit unserem breit gefächerten Angebot an Zeitschriften, Online-Inhalten und Videos sind wir der führende Verlag für diese Zielgruppen. Vertiefen Sie Ihr Wissen mit unseren penibel recherchierten, professionell geschriebenen und modern gestalteten Fachmedien und bleiben Sie stets am Puls der Zeit.


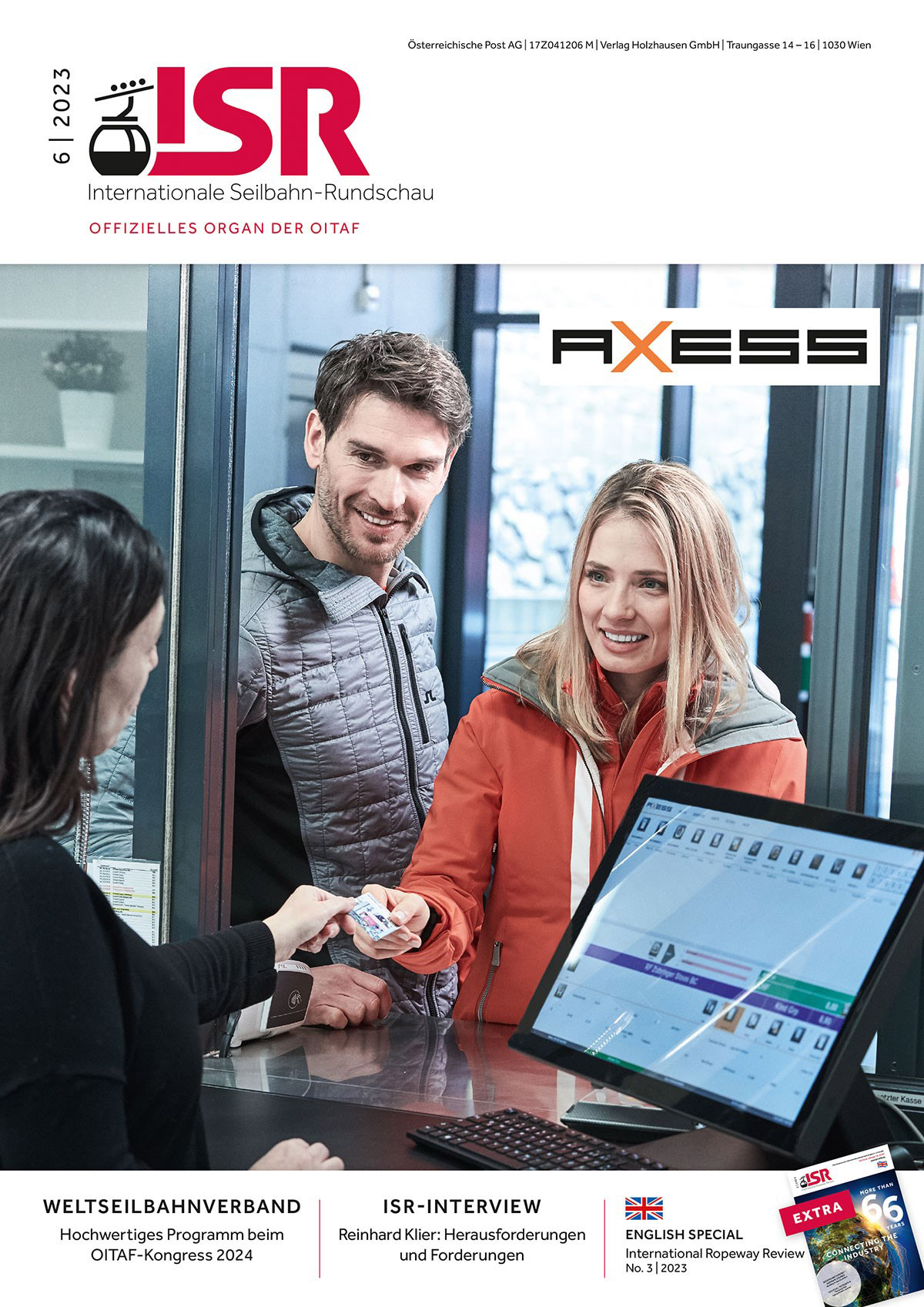

Austria Innovativ
Austria Innovativ verteidigt seit über 30 Jahren den Ruf als führendes Magazin für Wissenschaft, Innovation und Forschung in der österreichischen Wissens- und Forschungs-Community. Die Zeitschrift bietet umfassende Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen in den Bereichen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Smart Industry, Umwelttechnik, Nachhaltigkeit, Innovation und Technologie. Als Leitmedium in diesem Bereich präsentiert Austria Innovativ nicht nur herausragende Technologieprodukte und erfolgreiche Unternehmen, sondern auch die Menschen und Institutionen hinter den Innovationen. Das Magazin bringt Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen. Zusätzlich wird die eigene Veranstaltungsreihe Austria Innovativ Forum als Plattform für tiefgründige Diskussionen genutzt, um aktuelle Themen und Trends zu vertiefen und innovative Lösungsansätze zu erarbeiten.
Ausgaben pro Jahr: 6 | Auflage: 12.500. Stück | Mediadaten | Website

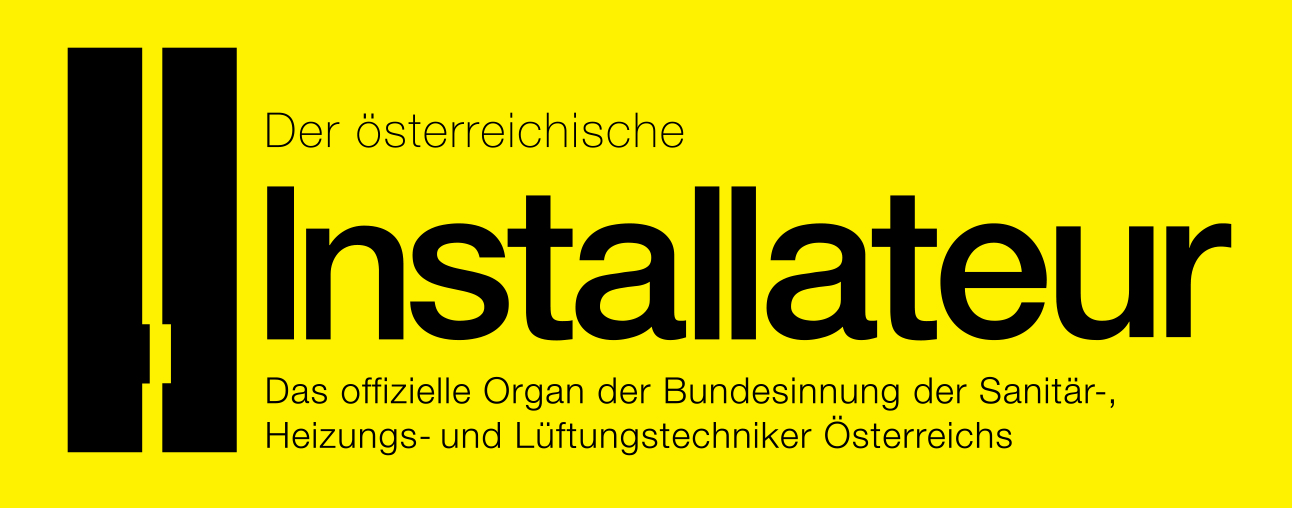
Der österreichische Installateur
Der österreichische Installateur ist seit 1947 das offizielle Organ der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs. Die Heftinhalte decken diverse Themenbereiche ab, darunter Sanitär, Heizung, Klima/Lüftung, Installationstechnik, gewerkeübergreifendes Bauen und Service/Karriere. Von Trends in der Badausstattung bis hin zu Innovationen in der Heiztechnik und Energieeffizienz in der Klimatechnik bietet das Magazin fundierte Einblicke und Fachberichte für die gesamte Branche. Als Fachmedium für Unternehmer erreicht die Publikation höchste Aufmerksamkeit bei allen relevanten Entscheidungsträgern der Branche sowie die wichtigsten Architekten, Bauträger, Planer Großhändler, Industrievertreter, Behörden und Bildungseinrichtungen.
Ausgaben pro Jahr: 12 | Auflage: 11.500 Stück | Mediadaten | Website
ISR – Internationale Seilbahn-Rundschau
Die ISR – Internationale Seilbahn-Rundschau ist das führende Fachmedium für die Seilbahnen und Skigebiete weltweit. Der Fokus der Zeitschrift liegt auf wissenschaftlich fundierten Berichten über aktuelle Entwicklungen. Seit 1957 begleitet die ISR redaktionell die globale Entwicklung der Seilbahn- und Skitourismusbranche. Mit mehrsprachigen Ausgaben und einer weltweiten Leserschaft in über 56 Ländern ist das Magazin eine unverzichtbare Informationsquelle. Die ISR veröffentlicht nicht nur technische Fachartikel, sondern auch Kommentare von Top-Experten aus der Branche. Die Leserschaft umfasst Geschäftsführer, Betriebsleiter, Industrievertreter, Investoren, Architekten, Behörden und Ministerien.
Ausgaben pro Jahr: 6 + 5 Sonderausgaben (Länderspecials) | Auflage: 5.333 Stück | Mediadaten | Website


Verkehr
Die Internationale Wochenzeitung Verkehr informiert seit 1945 über Logistik, Transport, Verkehrspolitik und -wirtschaft, Lagertechnologie, Infrastruktur, Spedition, verladende Wirtschaft (Industrie und Handel) und Management. Als Österreichs führende Informationsquelle über Straßen-, Schienen-, Wasser- und Lufttransporte baut die Internationale Wochenzeitung Verkehr die Zahl der Leser kontinuierlich aus und setzt neben Print auch auf digitale Distributionskanäle. Durch Kooperationen und eigene Veranstaltungen baut das Fachmedium zudem sein Netzwerk weiter aus. Zum Repertoire der Internationalen Wochenzeitung Verkehr zählen auch regelmäßige Round-Table-Diskussionen zur Vertiefung aktueller Themen sowie die Logistik-Wahl, in Rahmen der Auszeichnungen für herausragende Leistungen verliehen werden. Dank der multimedialen 360°-Orientierung des Mediums werden Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sowie Experten in Transport- und Logistikunternehmen, öffentlichen Institutionen, Verbänden und Bildungseinrichtungen als Leser erreicht.
Ausgaben pro Jahr: 20 | Auflage: 9.500 Stück | Mediadaten | Website
„Wissenschaftliche Exzellenz prägt unsere Bücher“

BUCHVERLAG
Ihr Experte für erstklassige wissenschaftliche Publikationen
Der Buchverlag bringt hochwertige wissenschaftliche Werke heraus und pflegt enge Partnerschaften, unter anderem mit dem Österreichischen Archäologischen Institut (ÖAI). Besonders hervorzuheben ist das renommierte Jahrbuch TYCHE, herausgegeben vom Institut für Alte Geschichte der Universität Wien. Ergänzend bietet der Buchverlag Publikationen des Instituts für Alte Geschichte, Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik an. Das Portfolio umfasst auch Werke aus der Slawistik und bedeutende Bücher aus anderen Bereichen, was die verlegerische Vielseitigkeit aber auch das Engagement für die Förderung des Wissens einmal mehr unterstreicht.
Entdecken Sie bei fesselnde und wegweisende Publikationen, die den Geist der Forschung widerspiegeln.
Digitale MEDIEN
Als Experten für Innovation und Forschung, Seilbahnen, Installationstechnik, Logistik und Transport bieten wir eine vielfältige Online-Plattform sowie reichweitenstarke Newsletter und Social-Media-Kanäle. Tauchen Sie ein in aktuelle Entwicklungen und praxisnahes Know-how, vernetzen Sie sich mit Experten und bleiben Sie stets informiert. Lassen Sie sich von unserer digitalen Welt inspirieren, informieren und verbinden.
Online-Plattformen
Unsere Webseiten fungieren als dynamische Online-Plattformen, die neben unserem Zeitschriftenangebot auch spezifische Brancheninhalte präsentieren. Wir bieten eine umfassende digitale Präsenz, die es unseren Lesern ermöglicht, sich über aktuelle Fachthemen zu informieren und auf aktuelle Inhalte zuzugreifen.
Newsletter
Unsere Newsletter sind das ideale Werkzeug, um eine direkte Verbindung zu Ihrer Zielgruppe herzustellen. Durch gezielte und hochwertige Inhalte liefern wir Ihre Botschaft effektiv und zielgerichtet an Ihr Publikum. Mit fachlich relevanten Informationen stärken wir Ihr Unternehmensimage und fördern die Interaktion mit Ihrer Marke.
Social Media
Maximale Reichweite für Ihre Botschaften – unsere Social-Media-Kanäle sorgen für eine breite Streuung Ihrer Inhalte, Pressemitteilungen und Botschaften auf diversen Plattformen. Durch gezielte Strategien und hochwertigen Content erreichen wir Ihre Zielgruppe und stärken die Präsenz Ihres Unternehmens in den sozialen Medien.
Leistungen
Ihr Produzent erstklassiger Publikationen
Als Ihr Partner für Produktion und Vertrieb moderner Print- und Digitalprodukte bieten wir ein Komplettservice an – von der Beratung über die Konzeption bis hin zur Umsetzung. Unsere langjährige Erfahrung in Redaktion, Gestaltung, Produktion und Vertrieb sowohl analog als auch digital ermöglicht es uns, Ihre Interessen präzise und wirkungsvoll zu präsentieren.
Medienkooperationen
Maßgeschneiderte Medienkooperationen für optimale Präsenz.
Der Verlag Holzhausen bietet maßgeschneiderte Werbelösungen, die Ihre Sichtbarkeit sowohl online über unsere Webseiten, Newsletter und Social-Media-Kanäle als auch in unseren Printmedien effektiv steigern. Durch die Kombination dieser Kanäle können wir Ihre Botschaft gezielt an Ihre Zielgruppe vermitteln. Von gezielten Anzeigenplatzierungen bis hin zu exklusivem Content – wir erreichen potenzielle Kunden und fördern Ihr Unternehmensimage.
Branchenevents
Verbinden, Austauschen, Wachsen.
Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Branchenevent zu organisieren, um Fachleute zu vernetzen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und die Kundenbindung zu festigen. Wir übernehmen für Sie die komplette Organisation, können inhaltliche Inputs liefern und zusätzlich unterstützen wir Sie bei der Verbreitung. Wir kündigen Ihr Event sowohl im Printmedium als auch auf all unseren Online-Kanälen an, damit Sie Ihre Zielgruppe erreichen. Zusätzlich halten wir Ihr Event fest in Form eines redaktionellen Beitrags, einer eigenen Beilage oder einem Video. Als Veranstalter bzw. Medienpartner ist es unser Ziel, eine einzigartige Plattform zu bieten, um Ideen auszutauschen, innovative Ansätze zu diskutieren und Partnerschaften zu fördern.
Corporate Publishing
Präsentation zielgerichteten Publikationen für Ihre Ziuelgruppe.
Unsere auf Ihre Bedürfnisse angepasste Dienstleistung verfolgt das Ziel, die einzigartige Geschichte und Vision Ihres Unternehmens in hochwertigen und zielgerichteten Publikationen zu präsentieren. Von maßgeschneiderten Mitarbeiterzeitungen und Kundenmagazinen bis hin zu ansprechenden Broschüren und digitalen Inhalten – wir bringen Ihre Unternehmenswerte zum Ausdruck und vermitteln sie auf kreative und überzeugende Weise!
Customized Podcasts
Mit unserem Podcast-Service bieten wir Ihnen die Möglichkeit, einen Podcast zu entwickeln und zu produzieren, der genau auf die Bedürfnisse und Ziele Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Wir unterstützen Sie nicht nur bei der Konzeption, der inhaltlichen Gestaltung und der technischen Produktion damit Ihr Podcast Ihre Marke stärkt und Ihre Botschaft effektiv vermittelt. Unsere erfahrenen Teams begleiten Sie von der Idee bis zur Veröffentlichung und Vermarktung, damit Sie Ihre Zielgruppe erreichen und erfolgreich ansprechen können.
Customized Videos
Unser Customized-Video-Service bietet individuelle Lösungen zur effektiven Kommunikation Ihrer Unternehmensbotschaft. Von der Konzeption bis zur Produktion verwandeln wir Ihre Ideen in ansprechende visuelle Inhalte, die Ihre Zielgruppe überzeugen. Unsere Experten arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass das endgültige Produkt Ihren Anforderungen entspricht. Ob Imagevideos, Werbevideos, Produktvorstellungen, Schulungen oder Unternehmenspräsentationen – wir liefern maßgeschneiderte Videolösungen, die Ihre Marke hervorheben.
Betreuung Buchprojekt
Der Verlag Holzhausen bietet umfassende Dienstleistungen für Autoren, die ihr Buch veröffentlichen möchten. Von der Manuskriptüberprüfung über das Lektorat bis hin zur Covergestaltung und Formatierung – wir kümmern uns um alle Schritte des Publikationsprozesses. Darüber hinaus bieten wir Unterstützung bei der Vermarktung und Verbreitung Ihres Buches, um sicherzustellen, dass es die maximale Aufmerksamkeit erhält. Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem engagierten Team stehen wir Ihnen zur Seite, um Ihr Buchprojekt erfolgreich umzusetzen.